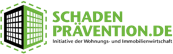Da aber die meist pseudowissenschaftliche Diskussion um das Schimmelproblem gedämmter Wände oftmals eine gewisse Plausibilität vermittelt, hier noch ein bisschen Futter für all jene, die sich künftig – fachlich fundiert – an der Diskussion beteiligen möchten.
Falsches Wissen
Jeder „weiß“, dass nach dem Fenstereinbau das Haus dichter ist und man deshalb mehr lüften muss, um Schimmel zu vermeiden. Dass dieses „Wissen“ falsch ist, lässt sich mit etwas bauphysikalischem Grundverständnis leicht herleiten. Fehlt dieses bauphysikalische Grundverständnis, glaubt man leider das, was halbwegs plausibel erscheint. So werden gelegentlich die wichtigen Dichtungen der nagelneuen Fenster mit dem Cuttermesser eingeschlitzt oder einfach rausgerissen, um den alten „Lüftungszustand“ wenigstens halbwegs wieder herzustellen.
Oder man verdonnert per Gerichtsbeschluss die Mieter, häufiger zu lüften. Ein Richter, der keine Ahnung von Bauphysik hat, entscheidet, was zu tun ist. Wenn der Richter doch nur wüsste, dass das Dauerlüften nicht nur die Heizkosten nach oben treibt, sondern dass durch verstärktes Lüften die Schimmelgefahr sogar noch steigen kann: weil nämlich der Raum inklusive Innenwände beim Lüften eventuell so weit auskühlt, dass sich auf den kalten Wandoberflächen Tauwasser bildet, das dann zu noch mehr Schimmel führen kann.
Beispiele aus der Praxis
Es ist eigentlich einfach zu verstehen, man muss sich nur drei Fälle anschauen:
Erstens: der Urzustand
Die alten Fenster haben im Winter eine Temperatur auf der Innenseite von geschätzten 10 Grad Celsius oder etwas weniger. Es entsteht Tauwasser (Kondensat, die Scheiben „beschlagen“). Das ist unproblematisch, weil das Tauwasser an der Scheibe nach unten fließt und sich schlimmstenfalls auf der Fensterbank als kleine Pfütze sammelt. Das Wasser muss man immer wieder mal wegwischen – Thema erledigt.
Ungedämmte Altbauwände haben eine etwas bessere Dämmwirkung als alte Fenster, die Oberflächentemperatur der Wände liegt auf der Innenseite dadurch höher, bei geschätzten 15 Grad Celsius. In den Ecken aber nur bei etwa 12 Grad Celsius. Gerade noch mal Glück gehabt: Denn der sogenannte Taupunkt liegt leicht darunter, etwa zwischen 10,5 und 12,0 Grad Celsius. Gut zu wissen: Auf Flächen, deren Temperatur kleiner oder gleich der Taupunkt-Temperatur ist, fällt Tauwasser aus. Auf den ungedämmten Wänden in unserem Beispiel gibt‘s keine Tauwassergefahr, weil selbst die kalte 12-Grad- Oberflächentemperatur der Zimmer-Ecken gerade noch über der Taupunkt-Temperatur liegt. Die Raumluft muss zwar auf bis zu 23 Grad Celsius erwärmt werden, damit man sich behaglich und wohlfühlt – trotz der kalten Flächen, die einen umgeben. Bis auf die extrem hohen Heizkosten ist die Welt aber in Ordnung.
Zweitens: Neue Fenster werden eingebaut
Neue Fenster haben innen wegen ihrer – im Vergleich zu alten Fenstern – guten Dämmwirkung eine höhere Oberflächentemperatur (ca. 18 Grad Celsius) als die alten Fenster (ca. 10 Grad Celsius). Im Raum wird es wegen dieser warmen Flächen behaglicher, man kann die Heizung etwas runterdrehen (zum Beispiel auf 21 Grad Celsius) und Heizkosten sparen. Das war mit dem Einbau der neuen Fenster ja auch beabsichtigt. Die kühlere Raumluft nimmt weniger Wasser auf, die Luftfeuchtigkeit steigt im Raum etwas an. Die Taupunkt-Temperatur steigt in der Folge ebenfalls leicht an, die Oberflächentemperatur der Wand fällt auf etwa 13,5 Grad Celsius, in den Ecken auf unter 10 Grad Celsius. Dort wird der Taupunkt jetzt leicht unterschritten. Die Konsequenz: Mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es Schimmel auf den Wänden.
Die 18 Grad warmen Fensterscheiben bleiben jetzt trocken, das Tauwasser bildet sich auf der Tapete als Feuchtigkeit, die man nicht sehen kann. Man kann sie auch nicht wegwischen. Sie zieht in die Wand ein und findet mit dem Tapetenkleister einen optimalen Schimmelnährboden. Die Mieter können sich dumm und dämlich lüften. Zwar wird die Luft zeitweise etwas trockener, die Wand-Oberflächen werden aber nicht wärmer. Im Gegenteil. Sie kühlen weiter aus, es kann noch mehr schimmeln. Wer jetzt viel lüftet, reduziert zwar kurzzeitig die Luftfeuchtigkeit und reduziert damit kurzzeitig auch die Schimmelgefahr, doch schon kurz nach dem Schließen der Fenster steigt die Luftfeuchtigkeit wieder an und Tauwasser kann auf den kalten Wänden ausfallen. Dauerlüften wäre jetzt fatal.
Drittens: Zu neuen Fenstern gehört eine Fassadendämmung
Wenn man neue Fenster in alte Wände einbaut, dann muss man sich auch die Fassade sehr genau anschauen und sie dämmen. Denn mit einer Fassadendämmung hebt man die Oberflächentemperatur (innen) der Wand auf bis zu 19 Grad Celsius und es kann kein Tauwasser mehr entstehen – und kein Schimmel.
Fazit:
Wenn man neue Fenster einbaut und danach die Wände schimmeln, sind nicht die neuen Fenster schuld. Und erst recht nicht die Mieter, die zu wenig lüften. Die Bauverantwortlichen sind einfach nur den halben Weg gegangen. Zu neuen Fenstern gehört eben immer auch eine Fassadendämmung.
Dipl.-Ing. Ronny Meyer
Quelle: Wohnungswirtschaft-heute Technik, AG26 / 2012
Ähnliche Artikel: