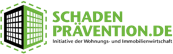Gravierende Schäden
Die entsprechenden Feuchtigkeitsschäden könnten gravierend sein – bis hin zur eingeschränkten Nutzung des Kellers, Schäden bei dort gelagerter Kleidung oder Büchern, Mängeln an der Bausubstanz oder gar gesundheitlichen Einschränkungen durch Schimmelpilze.
Feuchtigkeit aus warmer Luft setzt sich an kühlen Kellerwänden ab
Die Erklärung: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern als kühle. Lässt man warm-feuchte Luft von draußen herein, kann sie sich nun als Feuchtigkeit an den kühlen Kellerwänden absetzen – dieser Vorgang ist bekannt als „Schwitzen“. Man kennt das auch aus dem Haushalt, wenn eine kalten Flasche aus dem Kühlschrank mit Kondenswasser „beschlägt“.
Richtiges Lüften unerlässlich
Die Verursacher fragen sich dann, woher die Flecken im Kellerputz kommen. Gerade bei alten Häusern mit Natursteinmauern und kalten Steinböden gebe es dieses Problem, führt Günther Belz weiter aus. Bei einer Kellertemperatur von unter 12 Grad Celsius sollte man deshalb von Mai bis September die Kellerfenster lieber geschlossen halten, auf jeden Fall an heißen oder schwülen Tagen. Nur in kühlen Nächten, an kühleren Tagen oder auch an kühlen Regentagen sollte man den Keller lüften, wenn sich beispielsweise dort Wohnräume befänden.
Entgegen der landläufigen Annahme sei die Luft bei Regen weniger befeuchtet als warme Luft durch unsichtbaren Wasserdampf. „Wie in Wohnräumen in den oberen Geschossen lüftet man auch hier am besten kurz und kräftig bei weit geöffneten Fenstern“, so Günther Belz. Auch ein Hygrometer könne eine Orientierungshilfe sein, erläutert abschließend der Experte von Haus & Grund.
Günther Belz
Quelle: Wohnungswirtschaft-heute, Ausgabe 58, Juni 2013